Eine subjektive Einschätzung
Seit dem 27. November 2015 können wir wieder nachvollziehen, was deutsche Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren aktuell medial beschäftigt, welchen Stellenwert sie (welchen) digitalen Medien beimessen und was angesagt ist. Denn die neue JIM-Studie ist da. Für uns Medienpädagogen, die in der Praxis und im Feld mit Jugendlichen arbeiten und Erwachsenen Antworten geben sollen, ist die Studie viel Wert. Denn einmal mehr räumt die Studie mit einigen skandalisierten Vorurteilen rund um das Nutzungsverhalten junger Menschen auf. Und bietet uns repräsentative Belege (mit denen wir Erwachsene beschwichtigen können), wie junge Menschen medial ticken.
Kann man mithilfe der JIM-Studie im Feld für Entspannung sorgen? In vielen Fällen schon
Das ist wichtig, denn Vorurteile über „die Jugendlichen“, die exzessiv surfen und nichts anderes tun als buckelig durch die Straße zu laufen, keine echten Kontakte mehr pflegen und gar „Smombies“ sind, begegnen mir bei Elternabenden, Fortbildungen und Vorträgen mit Erwachsenen immer wieder. Da ist es umso wichtiger, dass man mit aussagekräftigen und validen Daten dagegen halten kann – spricht die Wissenschaftlerin in mir. Einerseits also danke für die Aufklärung, liebe Macher der JIM. Denn gerne zitiere ich Ergebnisse, die belegen, dass für viele junge Menschen Freunde immer noch am wichtigsten sind, dass Sport und Familie im Alltag eine große Rolle spielen[1], dass das Interesse an Büchern nicht abnimmt[2] und am aktuellen Zeitgeschehen an zweiter Stelle steht[3]. Scheint als seien jene Jugendlichen doch irgendwie normal(er), als ihre Eltern sie wahrnehmen. Denn nimmt man viele Eltern als Richtwert, dann haben wir es nur noch mit „Smombies“ und verlorenen Spielerseelen zu tun.
Was nun? Gibt es zu Hause nun Konflikte oder nicht? Praxis versus Wissenschaft
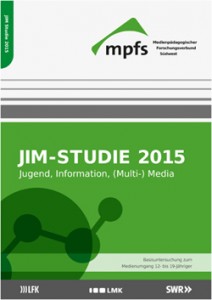
Daher überrascht mich ein Ergebnis der Studie: dass es scheinbar deutlich weniger Konflikte bezüglich der Nutzung verschiedener Medien in der Familie gibt als angenommen. Das kann ich – vor dem Hintergrund meiner Erfahrung in Elternabenden – nicht bestätigen. Relativieren wir: In der JIM-Studie kommen „nur“ die Jugendlichen zu Wort, die Eltern nicht. In meiner beratenden Tätigkeit als Medienpädagogin nehme ich das anders wahr, nämlich einen Alltag geprägt von immer früher beginnenden und regelmäßigen Konflikten zwischen Eltern und Heranwachsenden, bedingt durch die Mediennutzung. Die JIM-Studie gibt an, dass die Mehrheit der Jugendlichen nach eigener Einschätzung nie Stress oder Ärger wegen ihrer Mediennutzung hat. Jungen klagen – wenn überhaupt – noch am ehesten über Ärger beim Thema Zocken, bei den Mädels birgt das Thema Fernsehen tendenziell Konfliktpotenzial.
Wie? Jetzt doch kein Dauerstress wegen permanenter und nächtelanger WhatsApp-Aktivitäten, Eskalationen bezüglich Mediennutzung während der Hausaufgaben und Streitigkeiten aufgrund von Heimlichtuerei am Smartphone? Wo sind denn dann die Jugendlichen, mit deren Eltern ich spreche, die sich oft schon verzweifelt an mich wenden, weil sie nicht mehr weiter wissen? Oder klagen diese Eltern nur mir ihre Sorgen? Oder haben sie es gar aufgegeben, Regeln und Lösungen für ein (mediales) Miteinander zu finden? Nicht, dass ich den Stress zu Hause forcieren will – es wäre schön, wenn die Realität friedlicher abläuft, aber ich bin irritiert. Daher appelliere ich an die Macher der JIM, der Sache genauer auf den Grund zu gehen.
Schade: wenig Mut zur Lücke
Ein weiterer Kritikpunkt geht aus meiner Sicht als Praktikerin in Richtung „Mut zur Lücke“: Wieder, wie bereits in den Jahren zuvor, hat der mpfs sich nicht getraut (?), genauer nach sexualisierten Themen zu fragen. So wird zum Thema „Sexting“ nur die vage Kenntnis über das Thema[4] erfragt, nicht aber, ob die Befragten es selber machen. Verstehe ich nicht! Aus forschungsethischen Gründen könne man das die Jugendlichen am Telefon nicht fragen[5], argumentieren die Macher. Wieso das? – frage ich da ganz provokativ! Schade, denke ich im zweiten Schritt, damit verspielt die Studie wichtiges Potenzial. Eigentlich sollen „neben einer aktuellen Standortbestimmung (…) die Daten zur Erarbeitung von Strategien und Ansatzpunkten für neue Konzepte in den Bereichen Bildung, Kultur und Arbeit dienen. Können sie aber nur bedingt, wenn wir die unangenehmeren Themen konsequent ausklammern und dadurch bis auf Weiteres im Dunkeln tappen. Nach wie vor können wir nur auf wenige Studien aus anderen Ländern zurückgreifen, wenn wir z.B. das Vorkommen von „Sexting“ bzw. den Austausch erotischer Bilder unter Jugendlichen respektive den Umgang mit diesem Thema thematisieren wollen. Damit fehlen uns nicht nur Daten, die sich wirklich auf deutsche Heranwachsende beziehen, sondern auch jene notwendigen Belege zur Erarbeitung von Strategien und Ansatzpunkte für neue Konzepte in unbequemen Bereichen. Schade.
[1] JIM-Studie 2015, S. 9
[2] JIM-Studie 2015, S. 22
[3] JIM-Studie 2015, S. 16
[4] „Im Bekanntenkreis hat jemand schon einmal erotische Fotos/Filme per Handy oder Internet verschickt.“ (JIM-Studie, S. 51)
[5] JIM-Studie 2015, S. 51
